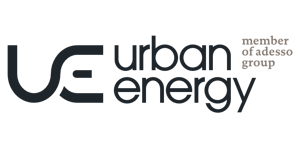Mieterstrom adé, Energy Sharing olé
Nach dem BGH-Urteil zur Mieterstrom-Praxis und der Kundenanlagen-Einordnung machte sich große Ernüchterung breit: Erste Kundenlagen mussten abgeschaltet werden, Mieterstrom-Kunden verunsichert, Zukunftsperspektiven unklar, Geschäftsmodelle zunächst blockiert. Die unscharfen Konturen des neuen § 42 c ENWG ließen noch keine verheißungsvollen Perspektiven erkennen. Das hat sich nun zum Positiven geändert: Mit den Bundesrats-Kommentaren versehen, geht dieses neue Gesetz nun in die zweite Lesung in den Bundestag. Eine detaillierte Drucksache des Bundestages gibt nun Aufschluss über die begrüßenswerte Gesamtrichtung des Gesetzgebungsverfahrens.
Drucksache 21/2076 des Bundestages
Der Bundesrat hatte im Zuge der laufenden Novellierung des Energiewirtschaftsrechts eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben, mit der er zentrale Nachbesserungen fordert. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht unter anderem die Einführung von § 42c EnWG-E „Energy Sharing“ vor – also die Möglichkeit, dass Stromerzeugung und Verbrauch innerhalb enger räumlicher oder organisatorischer Zusammenhänge flexibler geregelt werden. Darauf hatten viele gestaltungswillige Wohnungswirtschaftler gewartet. Ein gründliches Studium des Für und Wider aus der Drucksache ist aber keinesfalls ohne Nutzen: Der tatsächlich erkennbare Konsens-Anteil aus Bundestag und Bundesrat gibt bereits Grund zur Annahme, dass viele scharrende Hufe im Hintergrund demnächst los gallopieren können.
Forderungen des Bundesrats
In seiner Drucksache (21/2076) hebt der Bundesrat hervor, dass das geplante Energy Sharing zwar ein wichtiger Schritt sei, jedoch erhebliche Rechts- und Praxisunsicherheiten bestehen. Die zentralen Punkte:
- Ausweitung des Teilnehmerkreises: Es solle geprüft werden, ob nicht statt einer „Anlage“ mehrere Anlagen zusammengefasst werden dürfen – um administrative Hürden zu senken.
- Vereinfachung der Vertrags- und Messverhältnisse: Der Bundesrat stellt in Frage, ob zwingend zwei oder mehrere Verträge notwendig sind oder ob ein einziges Vertragsverhältnis ausreichend sein könnte.
- Entlastung bei Umlagen und Netzentgelten für ortsnahe Shared-Modelle: Es wird vorgeschlagen, solche Modelle ggf. privilegiert zu behandeln.
- Klarere Begriffsbestimmungen: Zum Beispiel zur Abgrenzung zwischen „Kundenanlagen“ und Netzbetrieb, um Rechtssicherheit für Betreiber und Verbraucher zu verbessern.
Kontext & Bedeutung
Die Novelle des EnWG zielt darauf ab, das Stromsystem in Deutschland flexibler und dezentraler zu gestalten – unter anderem durch stärkere Mit-Beteiligung von Wohnungswirtschaft, Mietern, Bürgern, Unternehmen und Kommunen sowie durch neue Anlagen- und Netznutzungsformen. Der Bundesrat unterstreicht, dass gerade die praktische Umsetzbarkeit, der Bürokratieabbau und die Akzeptanz solcher neuen Modelle entscheidend seien.
Gleichzeitig weist er darauf hin, dass ohne präzise Regelung die Gefahr besteht, dass gerade innovative Modelle (z. B. Quartierslösungen, Gemeinschaftsanlagen) nur zögerlich genutzt werden. Wir hatten hier bereits in einem umfangreichen Whitepaper auf die Perspektiven hingewiesen.
Ausblick
Damit wird Planbarkeit, werden Geschäftsmodelle erkennbar. Geschäftsmodelle, auf die die Wohnungswirtschaft dringend wartet, um langfristig mit einer umfassenden “3. Säule” nach der Nettokaltmiete und den warmen BeKo wirkmächtig zur Gebäude-Energiewende beitragen zu können. Der Entwurf geht nun zurück an den Deutscher Bundestag, der die Stellungnahme des Bundesrats in der weiteren Beratung berücksichtigen wird. Die heute geforderten Klarstellungen und Erweiterungen könnten entweder im parlamentarischen Verfahren eingebaut oder über Änderungen im weiteren Gesetzgebungsprozess umgesetzt werden. Für Akteure der Wohnungs-, Energie- und Versorgungswirtschaft sowie für Kommunen und Bürgergenossenschaften gilt: Die Detailausgestaltung der Regelungen – insbesondere zu Verträgen, Umlagen und organisatorischen Modellen – nähert sich erkennbar verwertbaren Zielen.