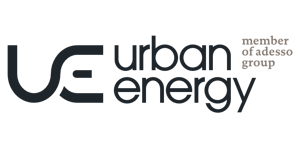Tiefengeothermie in Prenzlau – Das „Urmeer“ als Freshup-Beispiel der Wärmewende
Prenzlau entwickelt sich zu einem der spannendsten Standorte für tiefe Geothermie in Deutschland. Die uckermärkische Kreisstadt greift dabei auf ein geologisches Potenzial zurück, das bereits zu DDR-Zeiten bekannt und technisch erschlossen wurde: ein salzhaltiger Tiefen-Aquifer, das sogenannte „Urmeer“. Heute wird dieses Potenzial mit moderner Großwärmepumpentechnik und einem ausgebauten Fernwärmenetz zu einem zentralen Baustein der kommunalen Wärmewende weiterentwickelt. Die Stadtwerke Prenzlau haben in den vergangenen Jahren eine umfassende Machbarkeitsstudie zur „Neuauflage der Geothermienutzung“ durchgeführt. Ausgehend von den DDR-Altbohrungen wurden die geologischen Rahmenbedingungen neu bewertet, Hydraulik und Temperaturverhältnisse analysiert und verschiedene technische Szenarien durchgerechnet. Mit Erfolg – es ist ein echtes Beispiel zur Ermutigung in vergleichbare Aufsuchungen und Duplizierung an weiteren Orten entstanden, die über vergleichbare Quellen verfügen könnten. Für die Wohnungswirtschaft und deren Versorger ein echter “Hingucker” zur schnellen und kostengünstigen Dekarbonisierung ganzer Portfolien.
1. Das „Urmeer“
Unter Prenzlau befinden sich in etwa 900 bis 1.100 Metern Tiefe salzhaltige Sandstein-Aquifere aus dem Erdmittelalter. Dieses Tiefenwasser wird vor Ort als „Urmeer“ bezeichnet – ein Bild dafür, dass es sich um sehr altes, im Untergrund eingeschlossenes Meerwasser handelt. Messungen und Auswertungen der bestehenden Bohrungen zeigen, dass das Thermalwasser in dieser Tiefe eine Temperatur von rund 44 °C aufweist.
Die Geothermienutzung in Prenzlau ist keine Neuentwicklung auf „grüner Wiese“. Bereits 1987 wurde in der damaligen DDR eine geothermische Anlage mit zwei Bohrungen in Betrieb genommen, die Wasser aus rund 1.100 m Tiefe förderte. Diese Anlage speiste bereits damals Wärme in ein lokales Netz ein. Die historischen Erfahrungen, Bohrkerne und Betriebsdaten sind heute ein entscheidender Vorteil: Sie reduzieren die geologischen Unwägbarkeiten, die viele andere Standorte zunächst durch kostenintensive Explorationsbohrungen abklären müssen.
Damit ist Prenzlau kein „unbeschriebenes Blatt“, sondern ein Standort mit nachgewiesenem geothermischem Potenzial. Die heutigen Planungen knüpfen bewusst an diese bestehende geologische und technische Basis an, modernisieren sie jedoch grundlegend und erweitern sie in Richtung eines systematischen, großskaligen Wärmenetzes auf Basis erneuerbarer Energien. Andere Orte mögren Thermalquellen haben, die z.B. als “Thermalwasser” in Schwimmbädern im Einsatz sind (oder einst waren, danach ungenutzt blieben).
2. Das neue Tiefengeothermie-Projekt der Stadtwerke Prenzlau
Ein wichtiger Vorteil: Teile der vorhandenen Infrastruktur – insbesondere alte Bohrungen und Genehmigungsinhalte – können reaktiviert werden. Vorgesehen ist eine neue Förderbohrung auf etwa 1.000 m Tiefe (Gt Pr4) sowie die Reaktivierung einer bestehenden Reinjektionsbohrung (Gt Pr3/89). Zusammen bilden sie eine geothermische „Dublette“: Über eine Bohrung wird heißes Tiefenwasser aus dem Aquifer gefördert, über die andere nach der Wärmenutzung wieder zurück in das gleiche Gesteinspaket gepresst. So bleibt das Tiefenreservoir hydraulisch weitgehend im Gleichgewicht.
In den Jahren 2023 und 2024 wurden zunächst Rückbau- und Vorbereitungsmaßnahmen an der alten Anlage durchgeführt. Dazu gehörten der Rückbau alter, nicht mehr benötigter Komponenten, die Anpassung der bestehenden Bohrplätze sowie die planerische Vorbereitung der neuen Thermalwassertrasse. Nach aktuellem Planungsstand sollen 2025 die neuen Bohrarbeiten beginnen, ebenso wie der Bau der Verbindungsleitungen. Die obertägigen Anlagen, insbesondere Wärmetauscher, Großwärmepumpen und die Einbindung in das Fernwärmenetz, sollen bis 2026/27 fertiggestellt werden.
Technisch ist vorgesehen, rund 130 m³ Tiefenwasser pro Stunde zu fördern. Das Wasser hat nach heutiger Datenlage eine Temperatur von etwa 44 °C. Für eine direkte Nutzung in einem konventionellen Fernwärmenetz wäre diese Temperatur zu niedrig. Daher ist vorgesehen, das Thermalwasser zunächst in Wärmeübertragern auf einen separaten Heizwasserkreislauf zu koppeln und anschließend Großwärmepumpen einzusetzen, die die Temperatur auf etwa 75 bis 80 °C anheben.

Das Funktionsprinzip lässt sich so zusammenfassen: Das „Urmeer“-Wasser bleibt im geschlossenen Untergrund-Kreislauf, wird aber an der Oberfläche über Wärmetauscher und Wärmepumpen „angezapft“, um ein städtisches Fernwärmenetz mit ausreichend hoher Vorlauftemperatur zu speisen. Auf diese Weise verschmelzen bewährte hydrothermale Geothermie mit moderner Wärmepumpentechnik zu einem integrierten System.
3. Geplanter Nutzen und „Erfolg“ in Zahlen
Die Dimension des Projekts geht deutlich über eine Nischenlösung hinaus. Nach Angaben der Stadtwerke Prenzlau und verschiedener Fachquellen (u. a. Tiefe Geothermie, ZfK) soll die neue geothermische Anlage künftig bis zu 5.500 Haushalte in Prenzlau mit Fernwärme versorgen. Damit wird nicht nur ein großer Teil der privaten Wärmeversorgung auf erneuerbare Beine gestellt; auch öffentliche Gebäude und gewerbliche Verbraucher können von der geothermischen Wärme profitieren.
Besonders bemerkenswert ist die anvisierte Deckungsrate: Langfristig sollen rund 64 % des gesamten städtischen Wärmebedarfs aus dem „Urmeer“ stammen. In Kombination mit weiteren erneuerbaren Wärmequellen kann so ein nahezu vollständig dekarbonisiertes Fernwärmenetz entstehen – mit 2030 als wichtiger Zielmarke. Ein Mutmacher und Vorbild für Gemeinden, die in diese Richtung denken.
Neben der Klimawirkung spielt die Wirtschaftlichkeit eine zentrale Rolle. Durch die Nutzung lokaler, nicht preisgebundener Wärmequellen sollen die Fernwärmepreise stabilisiert und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen – insbesondere Erdgas – deutlich reduziert werden. In der Berichterstattung ist von Stadtwerken die Rede, die „44 °C warmes Urmeer anzapfen, um Heizpreise für die Wohnungswirtschaft und – vorrangig – Mieter stabil zu halten“.
Finanziell wird das Vorhaben durch die Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW) flankiert. Diese Förderung ist für viele Tiefengeothermieprojekte der zentrale Hebel, um die anfänglich hohen Kapitalkosten von Bohrungen, Wärmepumpen und Netzausbau abzufedern. Fachportale wie Tiefe Geothermie verweisen darauf, dass die BEW-Förderung für Prenzlau einen entscheidenden Beitrag zur Tragfähigkeit des Geschäftsmodells leistet.
Auch aus Sicht der Landespolitik spielt der Standort eine besondere Rolle: Brandenburg führt Prenzlau in seinen offiziellen Unterlagen und Fachpublikationen als Referenzstandort für Tiefengeothermie. Dort wird ausdrücklich auf die erfolgreiche Förderung von Thermalwasser in der Vergangenheit verwiesen – ein wichtiger Beleg dafür, dass die Konzeption der neuen Anlage auf empirisch gesicherten Grundlagen aufbaut (Quelle: mwae.brandenburg.de).
4. Meilensteine und öffentliche Wahrnehmung
Mit dem geplanten Bohrstart 2025 beginnt für Prenzlau gewissermaßen „das zweite Kapitel“ der geothermischen Nutzung. Fachportale zur tiefen Geothermie sprechen von einem neuen Abschnitt einer Geschichte, die bereits in den 1980er-Jahren begonnen hat. Die Reaktivierung und Modernisierung der alten Struktur wird dabei nicht nur als technisches Update verstanden, sondern als Paradigmenwechsel: Weg von fossilen Energien, hin zu einer dauerhaft verfügbaren, regionalen Wärmequelle. (Quelle: Tiefe Geothermie).
In regionalen Medien wie dem Nordkurier bzw. UckermarkKurier sowie in der kommunalen Fachpresse, etwa der „Zeitung für kommunale Wirtschaft“ (ZfK), wird das Projekt überwiegend positiv dargestellt. Es ist häufig von einem „Meilenstein“ für die Wärmewende in Ostdeutschland die Rede, Prenzlau wird als Vorbild für andere Mittel- und Kleinstädte genannt. Auch in Social-Media-Beiträgen von Unternehmen, Verbänden und Fachleuten taucht Prenzlau regelmäßig als Best-Practice-Beispiel für tiefengeothermische Wärmenetze auf.
Darüber hinaus findet sich Prenzlau in wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Kontexten. Berichte im Informationsdienst Wissenschaft (idw) zeichnen ein Bild von Geothermie als nachhaltiger, regional verankerter und sehr langfristig nutzbarer Wärmequelle. Geothermie wird dort häufig im Dreiklang mit Versorgungssicherheit, Klimaschutz und regionaler Wertschöpfung genannt – und Prenzlau dient als konkretes, anschauliches Beispiel für diese Kombination.
5. Offene Punkte, Herausforderungen und Risiken
Trotz der überwiegend positiven Bewertungen bleiben zentrale Herausforderungen. An erster Stelle stehen die hohen Investitionskosten. Tiefengeothermie erfordert teure Bohrungen in große Tiefen, eine robuste Netzinfrastruktur sowie leistungsstarke Großwärmepumpen. Studien und Projektunterlagen (u. a. BTU-Dokumente) machen deutlich, dass die Wirtschaftlichkeit stark von der BEW-Förderung und der Auslastung des Netzes abhängt.
Technisch bestehen, wie bei jeder tiefen Geothermie, Risiken hinsichtlich Förderraten, Wasserchemie und Materialbeanspruchung. Fragen wie: Bleibt die Förderrate langfristig stabil? Wie stark greifen Korrosion oder Ausfällungen die Anlagen an? und Wie zuverlässig funktioniert die Reinjektion? müssen durch Monitoring und Anpassung des Anlagenbetriebs beantwortet werden. Prenzlau startet hier mit dem Vorteil, dass bereits alte Bohrungen und Erfahrungswerte vorhanden sind.
Ein weiterer Aspekt sind gesellschaftliche und städtebauliche Fragen. Die Errichtung eines neuen geothermischen Heizwerks, Bohrplätze und Leitungstrassen bedeutet Baustellen in der Stadt – ein Zeichen für Aufbruch, Innovation und Zukunftsbewältigung. Fachportale wie Tiefe Geothermie weisen darauf hin, dass in Prenzlau bislang keine auffälligen seismischen Ereignisse im Zusammenhang mit der Geothermie verzeichnet wurden, das Thema aber generell in der öffentlichen Diskussion präsent ist und aktiv adressiert werden muss.
6. Einordnung und übertragbare Lehren
Prenzlau zeigt beispielhaft, wie tiefengeothermische Wärmeversorgung in einer mittelgroßen Stadt umgesetzt werden kann. Die Kombination aus bereits erprobter Geologie, vorhandenen Bohrungen, kommunalem Fernwärmenetz und gezielter BEW-Förderung schafft einen Rahmen, in dem tiefe Geothermie nicht nur technologisch, sondern nachweislich auch wirtschaftlich tragfähig wird.
Für andere Kommunen lassen sich mehrere Lehren ableiten: Erstens lohnt ein genauer Blick auf bestehende geologische Daten – alte Bohrungen, hydrogeologische Gutachten oder DDR-Altprojekte können eine wertvolle Grundlage sein. Zweitens ist der Aufbau bzw. die Dekarbonisierung eines Fernwärmenetzes ein entscheidender Hebel: Je höher die Wärmedichte, desto eher rechnen sich die hohen Anfangsinvestitionen. Drittens spielt eine integrierte Planung eine Rolle: Prenzlau nutzt Großwärmepumpen, um moderate Tiefentemperaturen auf ein für Fernwärme brauchbares Niveau zu bringen und kann so auch vergleichsweise „kühle“ Aquifere wirtschaftlich nutzen.
Schließlich zeigt Prenzlau, wie wichtig es ist, Wärmewende nicht nur als technisches, sondern als langfristiges kommunales Infrastrukturprojekt zu verstehen. Tiefe Geothermie bietet hier – bei aller Komplexität – die Chance auf eine stabile, regionale und klimafreundliche Wärmeversorgung, die im Idealfall über Jahrzehnte hinweg funktioniert und den fossilen Wärmemarkt schrittweise ersetzt.
Vor diesem Hintergrund wird Prenzlau in Fachkreisen bereits heute als Referenz- und Lernstandort betrachtet. Ob und wie schnell weitere Städte diesem Beispiel folgen, hängt maßgeblich von geologischen Gegebenheiten, politischen Prioritäten, der Verfügbarkeit von Fördermitteln und der lokalen Akzeptanz ab. Dass tiefe Geothermie aber eine tragende Rolle in der zukünftigen Wärmeversorgung spielen kann, zeigt der Blick nach Prenzlau bereits jetzt sehr deutlich.
Last but not least ist ein weiterer gesellschaftlich wichtiger Aktivposten in Prenzlau geboren: die Fachkräfte-Ausbildung. Rund um die Fa. GNT und den Lehrstandort wurde eine Vielzahl spezialisierter Ingenieure und Facharbeiter in vier Jahrzehnten ausgebildet, die nun “hinaus in die Welt” gingen (und in erklecklicher Anzahl in Berlin “hängenblieben”). Eine unendlich wertvolle Ressource, um die Erschließung von 300 TWh tiefengeothermischen Potenzials in Deutschland umsetzen zu helfen.