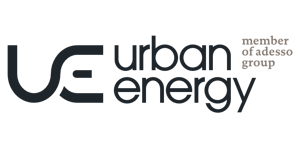GEG-Novelle: Warum der Koalitionsausschuss jetzt ins Spiel kommt
Berlin, den 27.11.2025
Kurze Zusammenfassung:
Die Beratungen im Koalitionsausschuss zur Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) deuten nun auf ein konservatives Kompromissergebnis hin. Im Mittelpunkt steht die politisch umkämpfte 65-Prozent-Regel für neue Heizsysteme, die weiterhin den Kern der deutschen Wärmewende bildet. Während die Union eine Anpassung fordert, hält die SPD an der Regel fest. Der Koalitionsausschuss fungiert dabei weniger als Motor der Veränderung, sondern als stabilisierendes Element zur Konfliktentschärfung. Die Grünen bleiben bei ihrer Realitäts-Abgewandtheit; weitere ernst zu nehmende Statements existieren aktuell noch nicht.
Im wahrscheinlichsten konservativen Szenario bleibt die 65-Prozent-Regel formal bestehen, wird jedoch über weichere Ausnahmen, verlängerte Übergangsfristen und CO₂-Nachweise flexibilisiert. Der Fokus der Gesetzesbegründung verschiebt sich hin zu einer „CO₂-Vermeidungslogik“ im Sinne des GdW-Praxispfades, ohne dass neue harte Verpflichtungen eingeführt werden. Förderprogramme sollen moderat angepasst und sozial stärker gewichtet werden, während technische Detailregelungen in nachgelagerte Verordnungen verschoben werden.
Die Wohnungswirtschaft bleibt in einem vorsichtigen Modernisierungspfad, abhängig von kommunalen Wärmeplänen und Förderkulissen. Für Handwerk und Industrie entsteht ein stabiler, jedoch nicht dynamisch wachsender Markt für erneuerbare Heiztechnologien.
Aus klimapolitischer Sicht führt ein konservatives Ergebnis zu einer Stabilisierung des bisherigen Fortschritts, jedoch ohne nennenswerte Beschleunigung. Politisch wird der Konflikt innerhalb der Koalition entschärft, aber nicht gelöst — grundlegende Richtungsentscheidungen bei steigenden Energiepreisen oder neuen EU-Vorgaben bleiben unausweichlich. Insgesamt entsteht ein Szenario der kontrollierten Anpassung: kein Rückschritt, aber auch kein Durchbruch.
Fazit: Stabilisierung statt Transformation. Der Konflikt wird entschärft, aber nicht gelöst — die großen Entscheidungen der Wärmepolitik stehen weiterhin bevor.
Ausführlich:
Warum der Koalitionsausschuss jetzt ins Spiel kommt
- Die GEG-Novelle (oft in der Kritik wegen der 65-%-Regel für neue Heizungen) spaltet die Regierungskoalition:
Die CDU/CSU-Seite will die 65-%-Erneuerbarenpflicht kippen bzw. lockern, während Vertreter der SPD und Teile der Koalition an ihr festhalten. - Der Koalitionsausschuss dient traditionell als zentrales Steuerungsgremium der Bundesregierung, wenn große Koalitionskonflikte gelöst werden müssen — etwa bei kontroversen Gesetzesvorhaben.
- In der aktuellen Berichterstattung (Nov 2025) heißt es, der Koalitionsausschuss werde als Ort genannt, an dem über die künftige GEG-Fassung entschieden werden soll — speziell darüber, wie streng oder technologieoffen die neue Regelung werden wird.
➡️ Deshalb kursiert die Meldung, der Ausschuss könne „Bewegung“ erzeugen — also einen Kompromiss finden, mit dem das Gesetz machbarer wird (Wohnungswirtschaft, Wärmebranche).
⚠️ Was steckt hinter der „Bewegung“ — mögliche Szenarien
Wenn der Koalitionsausschuss aktiv wird, sind folgende Optionen denkbar:
- ✅ Lockerung der 65-%-Regel — z. B. mehr Technologieoffenheit (Wärmepumpe, Solarthermie, Biomasse, Gas-Hybrid, etc.)
- ✅ Einführung von Übergangsfristen oder „Übergangsregeln“ (z. B. Bestandsschutz, lang laufende Bestandsanlagen)
- ✅ Sozial verträgliche Anpassungen — z. B. Kombi mit Förderungen oder Mieterschutz bei Heizungsumstellungen
- ✅ Klare Ausnahmen oder Sonderregelungen für bestimmte Gebäudetypen (Industrie, Gewerbe, Bestandsquartiere)
- ✅ Vereinfachte Anforderungen bei Neubauten / Sanierungen, um Planungssicherheit zu schaffen
Solche Änderungen könnten das Gesetz deutlich weniger brisant machen und Umsetzungsrisiken senken — was insbesondere für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft relevant wäre.
📅 Warum gerade jetzt — aktueller Kontext
- Nach dem letzten Stand herrscht starker interner Widerstand innerhalb der Regierung.
- Der Druck auf die Koalition steigt — sowohl aus Wirtschaft, Industrie und Wohnungswirtschaft als auch aufgrund steigender Energie-/Heizkosten und sozialer Verantwortung.
- Der Koalitionsausschuss bietet den politisch notwendigen Rahmen, um Lösungen „hinter verschlossenen Türen“ auszuverhandeln und Gesetzesvorhaben handhabbar zu machen.
🔍 Wie verlässlich ist die Meldung — und was zu beachten ist
- Der Koalitionsausschuss hat keine parlamentarische Macht per se — er kann Vorschläge machen, aber Beschlüsse müssen Parlament und ggf. Bundesrat passieren.
- Eine „Bewegung“ heißt nicht automatisch, dass gute oder sozialverträgliche Ergebnisse herauskommen — oft sind Kompromisse das Ergebnis.
- Es gibt bisher keine offizielle Gesetzesfassung mit finalen Änderungen. Alles, was kursiert, sind Entwürfe und Verhandlungspositionen.
🧭 Einschätzung: Für wen ist das relevant — und was bedeutet das
Für Vorhaben im Bereich Dekarbonisierung / fossilfreie Heiztechnik / Wohnungswirtschaft:
- Chancen:
- Wenn die 65-%-Regel gelockert oder flexibler gestaltet wird, steigen die Optionen — z. B. Kombinationen aus Wärmepumpe + Solar + Speicher werden praktikabler.
- Die geplante Neufassung des § 42 c ENWG eröffnet zusätzliche Chancen für Energy Sharing, nachdem Mieterstrommodelle nach § 42 a per BGH-Urteil unrentabel wurden.
- Mehr Technologieoffenheit und klarere Ausnahmen könnten Planungssicherheit und Investitionsbereitschaft erhöhen.
- Risiken:
- Gesetz kann auch verwässert werden — dann bleiben rechtliche Unsicherheiten.
- Ohne starke Förderung könnten nachhaltige Lösungen wirtschaftlich weniger attraktiv bleiben.
- Empfehlung:
- Die Ergebnisse des Koalitionsausschusses und Bundestags-/Bundesratsverfahren sollten hauteng “unter Kontrolle” bleiben — sie könnten kurzfristig Einfluss auf Marktentwicklung und Investitionssicherheit haben.
- Strategische Optionen: Konzepte für fossilfreie Heiztechnologien und Demonstrationszentrum könnte mit einem flexibleren GEG an Bedeutung gewinnen.
Konkretes konservatives Szenario:
Im Koalitionsausschuss, der sich derzeit mit dem sogenannten Heizungsgesetz und der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) beschäftigt, geht es um mehr als nur technische Detailfragen: Es geht um die Grundlinie der deutschen Wärmewende für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre. Ein „konservatives“ Verhandlungsergebnis – also eine eher vorsichtige, konfliktreduzierte Anpassung der bisherigen Regeln – ist dabei ein realistisches Szenario.
Wie könnte ein solches konservatives Ergebnis aussehen, welche politischen Kräfte stehen dahinter und was bedeutet es für Eigentümer, Wohnungswirtschaft und Energiewende?
Ausgangslage: Ein umstrittenes Gesetz, eine neue Koalition
Das aktuell geltende Gebäudeenergiegesetz schreibt vor, dass neue Heizungen in Neubauten – und in Bestandsgebäuden nach Vorliegen der kommunalen Wärmeplanung – zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Diese 65-Prozent-Regel steht im Zentrum des politischen Streits: Sie ist für SPD und Klimaschützer ein Kerninstrument, um die Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen, und für Teile der Union ein Symbol für Überregulierung und soziale Überforderung.
Die neue schwarz-rote Koalition aus CDU, CSU und SPD hat im Koalitionsvertrag vereinbart, das bisherige „Heizungsgesetz“ abzuschaffen und durch ein neues, „technologieoffeneres, flexibleres und einfacheres“ GEG zu ersetzen. Als zentrale Steuerungsgröße soll künftig die erreichbare CO₂-Vermeidung gelten. Diese Formel erlaubt in der Praxis große Spielräume: Weg von konkreten Technologiequoten hin zu abstrakteren Klimazielen, die über unterschiedliche technische Lösungen erreicht werden können.
Konfliktlinien: 65-Prozent-Regel vs. Technologieoffenheit
In der schwarz-roten Koalition verlaufen die Bruchlinien relativ klar:
- Die Union drängt darauf, die 65-Prozent-Regel abzuschwächen oder ganz zu streichen und den Fokus stärker auf „CO₂-Einsparung“ und Technologieoffenheit zu legen. In der Debatte wird häufig argumentiert, die 65 Prozent seien „willkürlich“ gewählt und würden bestimmte Technologien – etwa effiziente Gasheizungen in Kombination mit Effizienzmaßnahmen – benachteiligen. In der Tat hatte das “Heizungsgesetz” der AfD große Wählerpotentiale zugetrieben. Dies in einem Umfang, der mit dem Sprung demokratiefeindlicher Parteien zwischen 1928 und 1932 vergleichbar ist.
- Die SPD will die 65-Prozent-Regel im Kern erhalten. Sie verweist auf den Expertenrat für Klimafragen und auf Verbände wie Verbraucherzentrale, Mieterbund und Gewerkschaften, die die Regelung als „tragende Säule des Klimaschutzes im Gebäudesektor“ ansehen, insbesondere in Verbindung mit Förderprogrammen. Auch diese Verbände hatten mit ihrer regressiven Haltung (die in deren Eigenbewertung “progressiv” ist) die Wählerwanderung Richtung 1932 mit befördert.
Dazu kommt Druck von außen: Stadtwerke und Branchenverbände fordern Planungssicherheit, kritisieren aber hohe Kosten und unklare Förderbedingungen. Viele kommunale Versorger sehen die Wärmewende als notwendig, warnen aber vor Überforderung ihrer Investitions- und Umsetzungsfähigkeit.
Rolle des Koalitionsausschusses: Konflikte einfrieren statt lösen
Der Koalitionsausschuss ist in diesem Setting weniger ein Ort für große Weichenstellungen als ein Krisenstab, der verhindern soll, dass die Auseinandersetzung um das Heizungsgesetz die gesamte Koalition blockiert. In aktuellen Berichten wird das Thema GEG-Novelle als eines der „strittigen Dossiers“ beschrieben, das neben Rentenpaket und Verbrenner-Ende auf der Tagesordnung steht.
Ein konservatives Ergebnis in diesem Rahmen bedeutet:
- Möglichst keine neue Grundsatzdebatte über Zielrichtung und Klimaziele.
- Minimale Änderungen, die der Union erlauben, Gesicht zu wahren, ohne die SPD-Position fundamental zu unterlaufen.
- Zeitgewinn – insbesondere mit Blick auf EU-Fristen zur Umsetzung der Gebäuderichtlinie (EPBD) und die Einführung kommunaler Wärmepläne.
Wie sähe ein konservatives Ergebnis konkret aus?
1. Die 65-Prozent-Regel bleibt – aber weicher und indirekter
In einem konservativen Szenario würde die 65-Prozent-Regel für neue Heizungen nicht aufgehoben, sondern eher „entdramatisiert“:
- Die Regel bleibt als Grundsatz bestehen: Neue Heizungen müssen langfristig überwiegend mit erneuerbaren Energien betrieben werden.
- Sie wird aber indirekt entschärft, indem:
- längere Übergangsfristen eingeführt oder bestehende gestreckt werden,
- Ausnahmen und „Härtefall“-Klauseln präzisiert werden,
- Ersatzinvestitionen in effizientere Gasheizungen unter bestimmten Bedingungen zugelassen bleiben, sofern ein CO₂-Reduktionsnachweis geführt werden kann.
Formal könnte die Koalition so sagen: Das Heizungsgesetz in seiner Ampel-Form ist „abgeschafft“, faktisch bliebe der Kernmechanismus aber erhalten, nur in eine neue Systematik verpackt.
2. CO₂-Vermeidung als neue Leitvokabel – ohne harte neue Instrumente
Ein zentrales Element des konservativen Ansatzes wäre, die „erreichbare CO₂-Vermeidung“ tatsächlich zur zentralen Steuerungsgröße zu erklären – wie dies schon von der Arbeitsgruppe “Praxispfad CO2-Reduktion” des GdW vorweg genommen wurde.
Konkret hieße das:
- In der Gesetzesbegründung und in Begleitpapieren wird stark auf Technologieoffenheit und CO₂-Effizienz abgestellt.
- Es werden eher Zielpfade und Indikatoren beschrieben als verbindliche, leicht überprüfbare Pflichten.
- Die Einhaltung dieser Pfade würde zunächst eher über Monitoring und Evaluationsberichte kontrolliert als über neue Sanktionsinstrumente.
Für die Praxis hieße das: Die Grundrichtung bleibt, aber der Zwangscharakter wird abgeschwächt. Dies sorgt bei den Grünen sicherlich für Verstimmung, hatten sie doch auf den demokratiefeindlichen Zwang gesetzt und sehen die Bevölkerung nun wieder in mehr Eigenbestimmung hinwegziehen.
3. Moderate Anpassungen bei Förderung und sozialen Flankierungen
Ein konservativer Kompromiss müsste auf die wachsende Kritik reagieren, dass die Energiewende im Gebäudebereich zum „Privileg für Besserverdienende“ zu werden droht nach dem Motto: “grün muss man sich leisten können”.
Denkbare Elemente:
- Moderate Aufstockung oder Konzentration der Fördermittel auf einkommensschwächere Haushalte und auf Mietwohnungen.
- Leichte Vereinfachung der Förderbedingungen (weniger Programme, klarere Richtlinien).
- Eventuell ein zeitlich befristeter „Sozialbonus“ oder höhere Fördersätze für bestimmte Einkommensgruppen.
4. Verschiebung strittiger Detailfragen in Verordnungen und nachgeordnete Verfahren
Statt im Koalitionsausschuss harte Linien zu ziehen, könnten strittige Fragen in die Ebene von:
- Rechtsverordnungen,
- technischen Richtlinien,
- späteren Evaluationsklauseln
verschoben werden. So ließe sich der politische Konflikt aufschieben, ohne das Gesetz zu blockieren.
Folgen für Eigentümer, Wohnungswirtschaft und Handwerk
Eigentümer und private Haushalte
Für private Eigentümer würde ein konservativer Kompromiss vor allem eines bringen: keine Revolution, sondern eine justierte Fortsetzung des Status quo.
- Wer in den kommenden Jahren eine Heizung tauscht, muss weiterhin mit erneuerbaren Energien planen – Wärmepumpe, Hybridlösungen, Fernwärme oder andere erneuerbare Optionen bleiben bevorzugt.
- Gleichzeitig könnten etwas längere Übergangsfristen und klarere Ausnahmen dazu führen, dass viele Investitionen zeitlich geschoben oder auf „Minimalvarianten“ ausgerichtet werden.
- Diejenigen Haushalte, die ohnehin investieren können, profitieren weiter von Förderung und langfristig niedrigeren Betriebskosten; Haushalte mit knapper Liquidität bleiben trotz sozialer Flankierung eher reaktiv als gestaltend.
Wohnungswirtschaft
Für Wohnungsunternehmen und Quartiersentwickler bringt ein konservatives Ergebnis vor allem Planungssicherheit ohne massiven zusätzlichen Druck:
- Die 65-Prozent-Logik bleibt im System – damit müssen größere Bestände mittel- bis langfristig auf erneuerbare Systeme umgestellt werden.
- Die Geschwindigkeit der Umstellung wird jedoch stärker von Förderkulisse, lokalen Wärmeplänen und Investitionszyklen der Unternehmen abhängen. Flankiert wird dies von massiven Aufstockungen der Förderungen z.B. bei unausgeschöpften Nullemissions-Energien wie Geothermie, Integration von Energien aus Abwasser- und Rechenzentren
- Komplexe Modelle wie Energy Sharing oder Quartierslösungen bleiben zwar interessant, werden aber durch das GEG allein nicht stark angeschoben. Dies übernehmen die parallel verabschiedeten Gesetze wie etwa das GeoBG und ENWG; hier zum Energy Sharing explizit der neue § 42 c. Die Wohnungswirtschaft bleibt damit vermutlich in einer Abwarte- und Selektivstrategie: dort aktiv, wo sich Business Cases klar darstellen lassen, ansonsten eher zurückhaltend.
Handwerk und Industrie
Für das SHK-Handwerk und die Heizungsbranche bedeutet ein konservatives Szenario:
- Die Nachfrage nach Wärmepumpen, Hybridlösungen und erneuerbaren Systemen bleibt grundsätzlich bestehen; die starke politisch getriebene Zuspitzung nimmt aber etwas ab.
- Klassische Gasheizungen bleiben im Bestand noch eine Zeit lang relevant, vor allem in Konstellationen mit Effizienzverbesserungen oder CO₂-Kompensation.
- Die Branche bekommt mehr Zeit, Kapazitäten aufzubauen, leidet aber weiter unter Unsicherheit über die mittelfristige Ausrichtung und Förderhöhe.
Klimapolitische Bewertung: Stabilisierung statt Beschleunigung
Klimapolitisch wäre ein konservatives Ergebnis ambivalent:
- Positiv:
- Die 65-Prozent-Regel und damit ein zentraler Hebel zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors blieben erhalten.
- Extremvarianten – etwa eine komplette Rücknahme ohne Ersatz – würden vermieden, was Rechtssicherheit und EU-Konformität unterstützt. Blaue Wählermigration aus Frust über die von der Ampel erzwungenen Extremvarianten könnte so weiter begrenzt werden.
- Der hinterherhinkende Gebäudesektor würde moderat beschleunigt.
- Negativ
- Die soziale Schieflage könnte sich weiter verstetigen, wenn vor allem breite Wählerschichten, etwa Mieter der kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungswirtschaft keine Entlastung der regressiven Grünzwänge sähen.
In der Summe wäre bereits ein solcher konservativer Kompromiss in Verbindung mit wirksamen Förderprogrammen ein echter Beschleuniger der Wärmewende.
Politische Dynamik: Konflikt vertagt, nicht gelöst
Politisch hätte ein solches Ergebnis vor allem einen Effekt: Es würde den akuten Konflikt innerhalb der Koalition abmildern und den Eindruck von Handlungsfähigkeit vermitteln – insbesondere gegenüber EU, Bundesrat und zu blau tendierenden Wählerschichten.
Gleichzeitig gilt:
- Die grundlegende Auseinandersetzung über Tempo und Tiefe der Transformation im Gebäudesektor wird damit moderat beschleunigt.
- Spätestens mit den nächsten Evaluationsberichten zu den Klimazielen oder bei steigenden Energiepreisen wird die Frage nach ambitionierteren Maßnahmen wieder auf die Tagesordnung kommen.
Fazit
In einem konservativen Szenario sorgt der Koalitionsausschuss bei der GEG-Novelle für eine kontrollierte Anpassung:
- Die 65-Prozent-Regel bleibt im Kern bestehen, wird aber demokratiefreundlich flexibler gefasst.
- Die neue Leitvokabel „CO₂-Vermeidung“ wird eingeführt, ohne sofort harte zusätzliche Pflichten nach sich zu ziehen.
- Sinnvolle bzw. dringend notwendige Umsetzungen im Sinne des “Praxispfades” des GdW erhalten die dringfend benötigte legislative Unterstützung.
- Förderkulissen und Ausnahmen werden angepasst.
- Für Eigentümer, Wohnungswirtschaft und Handwerk entsteht ein Umfeld, das weniger von Schocks geprägt ist.
Für die Wärmewende bedeutet das: kein Rückwärtsgang, aber auch kein Vollgas – eher der Versuch, die angezogene Handbremse wirksam zu lockern.